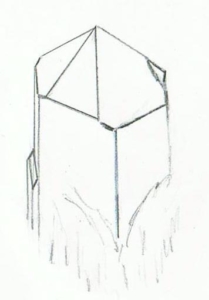von Ursula Klane 10/2025
Erich Kästner und die Kunst, Geschehnisse in lebendigen, realen Bildern darzustellen
Der deutsche Schriftsteller, Publizist, Drehbuchautor und Kabarettdichter Erich Kästner war ein großer Friedensertüchtiger – so wohl die treffende Vokabel heute im Jahr 2025. In seinem Schaffen wird er vermutlich häufig als Jugendbuchautor wahrgenommen. Einige seiner bekannten Jugendbücher wurden mehrfach verfilmt. Das doppelte Lottchen z.B. wurde 1994 von Regisseur Joseph Vilsmaier zeitaktuell verfilmt und hervorragend in Szene gesetzt in dem Film Charlie und Louise – Das doppelte Lottchen.
Verschiedene Epochen des Schaffens von Kästner könnten eine genauere Betrachtung erhalten. Bereits nach dem Ersten Weltkrieg – Kästner war noch ein junger Mann – wurde er in der Weimarer Republik bekannt als Mahner gegenüber jeglichem Missbrauch demokratischer Prozesse.
An dieser Stelle steht seine bildreiche Erzählkunst in der Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg in der Mitte. Kästner arbeitete nach 1945 in München, er leitete das Feuilleton einer Zeitung, brachte eine Kinderzeitschrift heraus und arbeitete in einem Kabarett mit. Teile dieser Arbeiten veröffentlichte er später in Der tägliche Kram – Chansons und Prosa 1945-1948.
Ein Beispiel aus seiner Arbeit für das Kabarett „Schaubude“ aus dem Jahr 1947 ist Das Lied vom Warten. Welches Leid der Krieg unter anderem angerichtet hatte, was Kästner bereits in den 1930er-Jahren vorausgesehen und wovor er gewarnt hatte, findet sich auch in dieser Aufführung wieder:
Frühjahr 1947, „Schaubude“:
Hintergrund: Noch immer befanden sich Millionen deutscher Soldaten in Kriegsgefangenschaft. Die Gemütsverfassung ihrer Mütter und Frauen, die oft nicht einmal wussten, wo die Männer waren und ob sie noch lebten, lastete wie ein Alpdruck auf allem und allen. Auch jetzt sind viele Gefangene noch nicht heimgekehrt. Seit die Friedensschlüsse länger brauchen als die vorangehenden Kriege, sind alle auf raschen Friedensschluss basierenden Klauseln und Bräuche sinnlos und bedenklich geworden.
Das Lied vom Warten
Eine Frau mit einem selbst gemalten Plakat steht an der Rampe. Auf dem Plakat klebt eine Fotografie. Außerdem steht mit einer Feldpostnummer groß „Hans Maier“ darauf. Hintergrundprospekt: Bahnhofshalle mit heimkehrenden Kriegsgefangenen.
1.
Zwei Jahre wird’s in diesem Mai,
da war der Totentanz vorbei,
da starb das große Sterben.
Wir traten vor das halbe Haus
und sahen nur: Der Krieg war aus.
Und sahen nichts als Scherben.
Doch auf dem Rest vom Kirchturm sang
die Amsel voller Überschwang,
und der Flieder, der blühte im Garten.
Die Bäume rauschten bis ins Blut.
Die Hoffnung sprach: „Es werde gut!
Geduld, mein Herz, Geduld, mein Herz,
dein bisschen Glück muss warten!“
Zwei Jahre werden es im Mai.
Mein Mann, der ist gefangen.
Er ist gefangen, und ich bin frei.
Die Hoffnung ging an uns vorbei.
Die Hoffnung ist vergangen.
Die Frau hebt ihr Plakat hoch und bringt das Folgende rezitativisch: (laut)
Schaut her, Kameraden meines Mannes,
Wer kann Auskunft geben
über den Gefangenen Hans Maier,
Maier mit a i,
wer kann Auskunft geben über meinen Hans?
Bitte, kommt näher, und lest das Schild.
Ich habe es selber gemalt, und unten rechts,
das ist er, das ist sein letztes Bild!
War jemand mit ihm im Lager? Wo kommt ihr her?
Aus Russland? Aus Frankreich? Erkennt ihn wer?
Er ist mein Mann, und ich brauch ihn so sehr.
Lacht mich nicht aus,
oder meinetwegen lacht hinter mir her!
Ich steh und wart, dass sich das Schicksal mein erbarme.
Schickt ihn doch heim.
Schickt ihn doch endlich heim in meine Arme!
2.
Die gleiche, bleiche Wartequal
hockt wie ein Geier überall
und hält uns in den Klauen.
Im Dunst der Stadt, im fernsten Tal –
ganz Deutschland ist ein Wartesaal
mit Millionen Frauen.
Die Amsel schluchzt, die Blumen blühn,
das Korn wird gelb, die Stare ziehn,
und der Winter rupft Federn im Garten.
Ein Mond wird schmal, ein andrer naht,
und rings ums Herz starrt Stacheldraht.
Geduld, mein Herz! Geduld, mein Schmerz!
Wir leben nicht – wir warten!
Wir warten stumm, dass sich die Welt unsrer erbarme.
Schickt sie doch heim.
Schickt sie doch endlich heim in unsre Arme!
Quelle: Erich Kästner Der tägliche Kram – Chansons und Prosa 1945-1948, Atrium-Verlag Zürich 2016